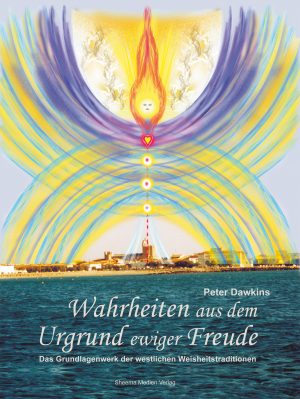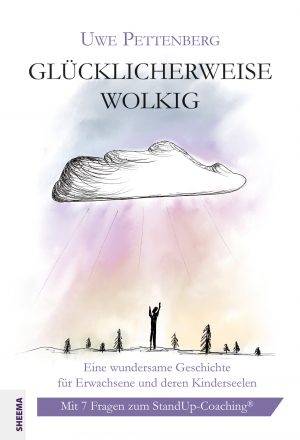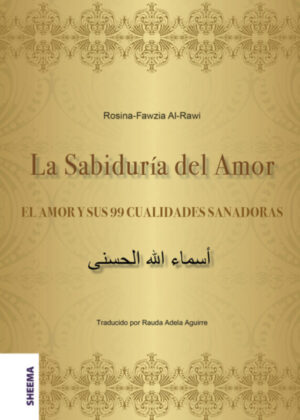Beschreibung
„Wenn du vollkommen still wirst, hörst du alles.“
Über das Hörbuch:
Ein einsamer Wanderer begegnet in der Wüste Sinai einem Meister, der ihm durch den Bericht des Tigers die Essenz des Zen Buddhismus nahe bringt. Eine Reise zur inneren Quelle mit Klängen aus den tiefen Räumen wortloser Weisheit. Zitat und Essenz des Tigerberichts: Wenn Du vollkommen still wirst, hörst Du alles.
Mehr zum Autor
Dietrich Wild
Dietrich Wild, geb. 1942, der Übermittler des „Tigerberichts“ stieß im Dezember 1975 im berühmt chaotischen Anglia Bookshop in München auf den bis dahin einzigen Text aus Suzuki-roshi´s Denken, das Buch...