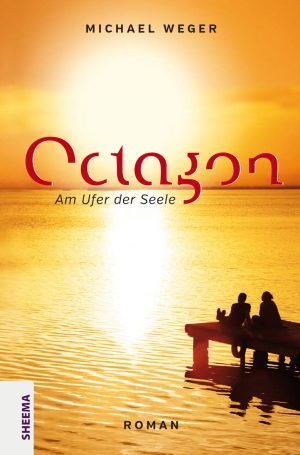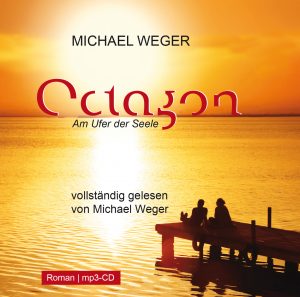Neonleuchten huschten über ihn hinweg. Er konnte nur blinzeln, was das Neonlicht flackern ließ, als wäre es defekt. Wie im Partykeller von Conny, dachte er. Sein Körper rutschte auf der Rollbahre hin und her, wenn die beiden Pflegehelfer zu schnell um Ecken bogen oder im Aufzug stoppten. Scheiße! Das is’n Krankenhaus! Dann übermannte ihn wieder die Schwere. Die Lider fielen ins Dunkel. Wenigstens waren seine Träume im Halbschlaf ohne die scharfen Konturen, die ihn viele Monate bei jedem Gedanken ins Hirn geschnitten hatten. Was er seit dem Unfall in seinen Beinen nicht mehr fühlen konnte, war stattdessen in den Kopf gewandert. Hatte sich dort ausgebreitet. War zu einer offenen Wunde geworden. Anfangs hatte er geschrien, später geweint, dann geschwiegen. Doch da hatte er den Plan bereits gefasst: Die erste Gelegenheit nutzen und die Pulsadern aufschneiden. So tief wie möglich rein mit dem Messer. Alles durchschneiden, was da ist. Auf beiden Seiten, links und rechts. Dass nix mehr zu machen ist. Dass es aus ist, die erbärmliche Scheiße! Diese Vorstellung war ihm, paradoxerweise, Ansporn genug, durchzuhalten. Denn nach dem Unfall und den ersten Tagen im Rollstuhl hatte seine Mutter, auf Anraten eines Jungendtherapeuten, alle spitzen und scharfen Gegenstände versteckt. Sie sollte sichergehen, so lange, bis sich alles beruhigt und der Junge sich abgefunden hätte. Also hatte er ausgeharrt und gewartet. Hatte das Rehaprogramm absolviert, den sündteuren Sportrollstuhl zu bedienen gelernt und wie man sich aufs Klo hievt, wenn alles taub und tot ist da unten, und wie man scheißt und pisst und trotzdem noch wichsen kann. Aber heute Morgen war es ihm gelungen. Jetzt hatten die Pfleger allen Grund zur Eile, denn der provisorische Druckverband des Sanitäters war bereits durchtränkt vom dunklen Blut der zerschnittenen Venen, doch auch vom hellen Blut der tiefer liegenden Arterien. Elias war gründlich gewesen. Ihm blieben nur noch Sekunden.
Ausführliche Leseprobe als PDF